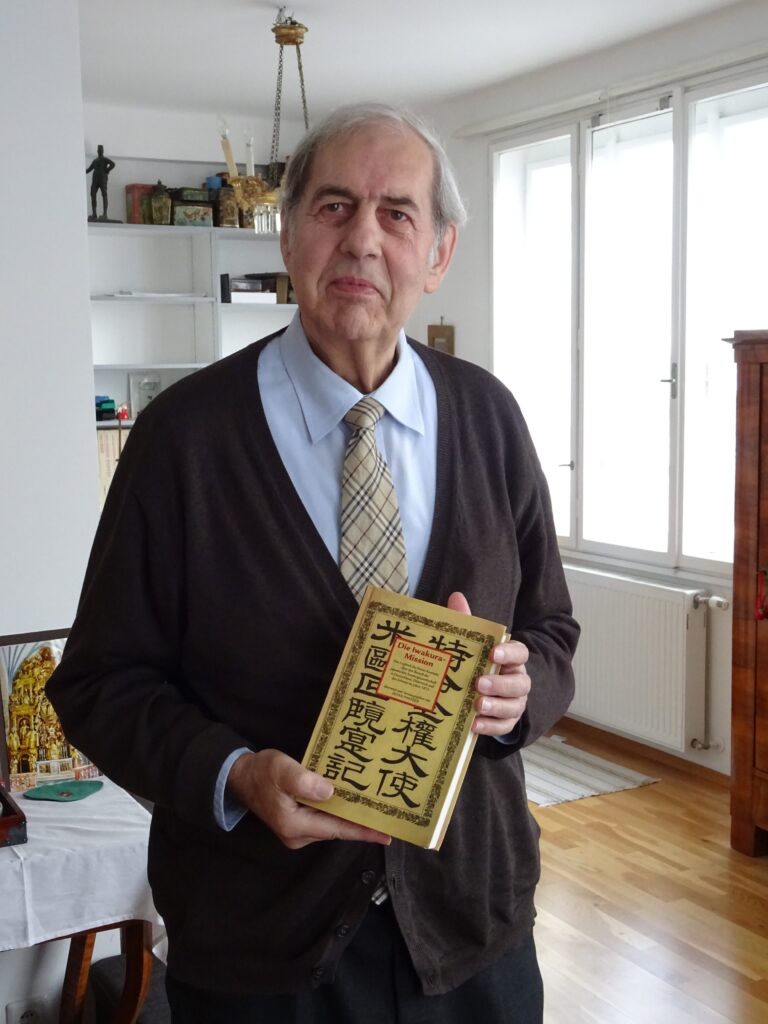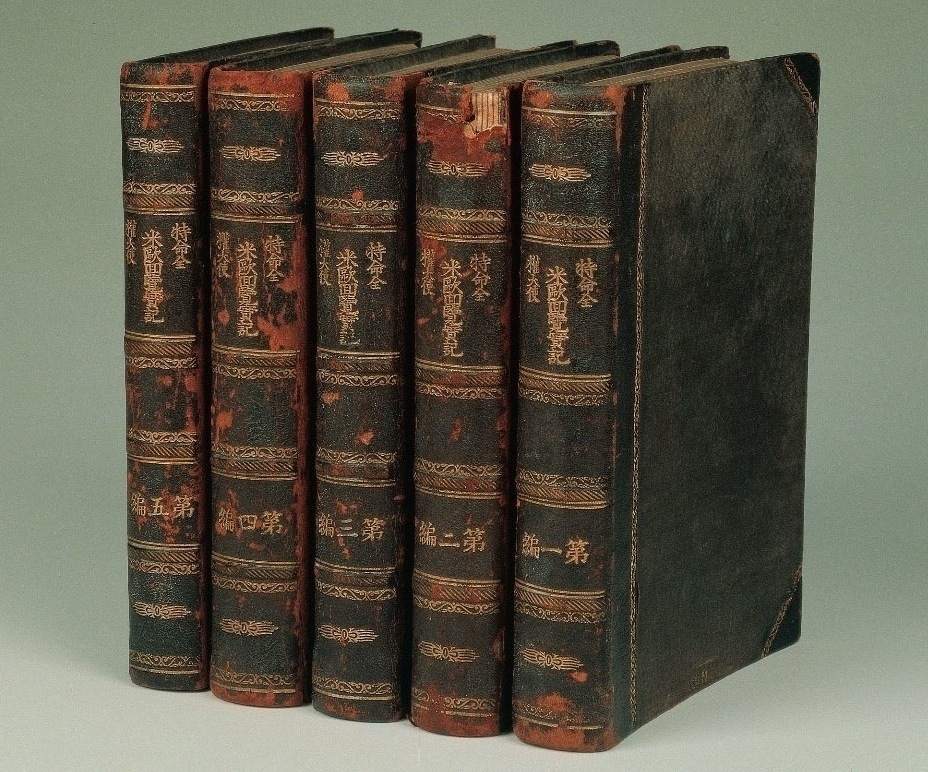Die bedeutendsten Ereignisse und Entwicklungen
der Japanisch-Österreichischen Beziehungen im Überblick.
der Japanisch-Österreichischen Beziehungen im Überblick.
1625: Erster Österreicher in Japan, Christoph Carl Fernberger
1869: Schließung eines Freundschafts-, Handels- und Schifffahrtsvertrag in Tokio durch Konteradmiral Anton Freiherr von Petz am 18. Oktober
1871: Vertrag tritt in Kraft nach der Unterzeichnung von Kaiser und Tenno
1873: In Wien findet die fünfte Weltausstellung statt mit dem Japanischen Kaiserreich als eines der Ausstellerländer im Rahmen der Iwakura-Mission
1907: Österreichisch-Ungarische Gesandtschaft erhält den Rang einer Botschaft, Entsendung einer Botschaft nach Wien von Seiten Japans
1914: Mit dem Ersten Weltkrieg werden die diplomatischen Beziehungen vorerst abgebrochen
1935: Gründung der Japanisch-Österreichischen Gesellschaft in Tokio durch Baron Mitsui Takaharu
1953: Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen
1955: Am 15. November erkennt Japan als erster Staat die Neutralität Österreichs an
1957: Neue Gesandtschaften in Tokio und Wien erhalten den Rang einer Botschaft
1965: Errichtung des Instituts für Japanologie in Wien
1999: Besuch des Bundespräsidenten Thomas Klestil in Japan
2002: Besuch des japanischen Kaiserpaares in Wien
2009: 140 jähriges Jubiläum, gegenseitige Staatsbesuche von Bundespräsident Heinz Fischer und Prinzenpaar Akishino
Text: Alexander Kuhn